Klimakrise, soziale Spaltung und das Versagen der Politik
Die neue schwarz-rote #GroKo hat ihr Sondierungspapier veröffentlicht, und es bestätigt, was viele befürchtet haben: Klimaschutz wird nicht ernst genommen. Doch das eigentliche Problem reicht tiefer. Es geht nicht nur darum, dass wir auf eine klimatische Katastrophe zusteuern – es geht darum, dass die politische Antwort auf diese Krise soziale Gerechtigkeit ignoriert.
Die Große Koalition wird keinen Weg finden, mit der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung umzugehen. Menschen, die ohnehin am Rand stehen – sozial Abgehängte, Menschen in prekären Verhältnissen, ländliche Bevölkerungsgruppen ohne Perspektiven – werden weiter ignoriert. In einer Zeit, in der alles teurer, instabiler und unsicherer wird, ist das eine Einladung an rechte Kräfte, einfache Antworten zu liefern.
Wir müssen also nicht nur überlegen, wie wir uns an das Klima anpassen, sondern auch, wie wir eine soziale Bewegung aufbauen, die verhindert, dass das Land nach rechts kippt.
1. Warum soziale Gerechtigkeit jetzt entscheidend ist
Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Zukunft haben, dann wenden sie sich denen zu, die ihnen einfache Erklärungen bieten. Klimaschutz ohne soziale Gerechtigkeit ist politisch nicht durchsetzbar, weil Menschen in existenziellen Krisen sich keine Gedanken über CO₂-Bilanzen machen – sie kämpfen darum, ihre Miete zu bezahlen oder genug zu essen zu haben.
Das Problem ist: Die Bundesregierung wird diesen Zusammenhang ignorieren.
- Die Erhöhung von CO₂-Preisen ohne soziale Ausgleichsmaßnahmen wird Unmut schüren.
- Unternehmen werden entlastet, während die Bevölkerung die Last trägt.
- Menschen, die sich abgehängt fühlen, werden auf rechte Rattenfänger hereinfallen, die das Thema „soziale Gerechtigkeit“ für ihre Zwecke missbrauchen.
Wir können nicht darauf warten, dass die Politik das Problem löst. Wir müssen soziale Gerechtigkeit selbst in die Hand nehmen.
2. Aufbau sozialer Netzwerke – von unten nach oben
Wenn die Regierung nichts tut, müssen wir uns selbst organisieren. Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Krisenzeiten sind die Zeit der Netzwerke. Wer alleine steht, ist verwundbar – wer in einer Community ist, hat eine Chance.
Was können wir tun?
- Nachbarschaftshilfe aufbauen: Wer in schwierigen Zeiten ein lokales Netzwerk hat, kann Druck von Individuen nehmen. Ob Lebensmitteltausch, gegenseitige Unterstützung bei Kinderbetreuung oder Fahrgemeinschaften – alles, was Menschen entlastet, stärkt den Zusammenhalt.
- Alternative Strukturen schaffen: Wenn staatliche Hilfen nicht kommen, müssen wir Wege finden, Dinge selbst zu organisieren – sei es durch Foodsharing, Genossenschaften oder kommunale Projekte.
- Wirtschaftliche Abhängigkeit verringern: Wer kann, sollte gemeinschaftliche Lösungen entwickeln, sei es für Energie (z. B. Solar-Kollektive), Wohnen (z. B. Hausprojekte) oder Mobilität.
3. Gegen Rechtsdruck aktiv werden – strategisch, nicht reaktiv
Der große Gewinner der kommenden Jahre wird die rechte Politik sein. Warum? Weil Menschen in Krisen nach Sicherheit suchen – und rechte Parteien tun so, als hätten sie einfache Lösungen.
Was müssen wir tun, um das zu verhindern?
- Die Erzählung besetzen: Rechte Bewegungen profitieren davon, dass sie „die einzigen“ sind, die über soziale Ungerechtigkeit sprechen. Wir müssen zeigen, dass soziale Gerechtigkeit nicht rechts ist.
- Präsenz zeigen: Rechte Netzwerke gewinnen dort, wo keine anderen Stimmen zu hören sind. In ländlichen Regionen, in sozialen Brennpunkten, auf dem Arbeitsmarkt – überall muss eine alternative Perspektive laut werden.
- Emotionale Kommunikation nutzen: Fakten reichen nicht. Menschen wählen aus Angst, Frust oder Hoffnungslosigkeit rechts – also müssen wir ihnen eine bessere Perspektive bieten.
4. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenken
Ein zentrales Problem der aktuellen Klimapolitik ist, dass sie oft als „Projekt der Eliten“ wahrgenommen wird. Das muss sich ändern.
- Klimaschutz muss bezahlbar sein: Es bringt nichts, auf teure E-Autos zu setzen, wenn Menschen sich nicht mal einen neuen Gebrauchtwagen leisten können. Wir brauchen Lösungen, die für alle funktionieren.
- Sozialer Klimaschutz bedeutet: Menschen mitnehmen, statt belehren. Wer sich Klimaschutz nicht leisten kann, fühlt sich bevormundet. Deshalb brauchen wir einen Klimaschutz von unten – mit echten Entlastungen für diejenigen, die es am meisten brauchen.
- Infrastruktur für alle: Der Ausbau des ÖPNV, klimafreundliche Wohnprojekte und Energiegenossenschaften müssen nicht nur in hippen Stadtvierteln, sondern auch auf dem Land und in einkommensschwachen Regionen passieren.
5. Selbstwirksamkeit statt Resignation
Es ist leicht, in Wut und Frust zu versinken. Doch das hilft niemandem – im Gegenteil. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir mehr Macht haben, als wir denken.
- Politik geschieht nicht nur im Bundestag: Sie passiert auch in Städten, Kommunen, Betrieben, Universitäten, Nachbarschaften. Dort können wir etwas bewegen.
- Veränderung braucht Praxis: Diskutieren alleine reicht nicht. Wer will, dass sich etwas ändert, muss praktische Alternativen entwickeln.
- Vernetzung ist der Schlüssel: Einzelne können wenig ausrichten – organisierte Gruppen können die politische Landschaft verändern.
Fazit: Die kommenden Jahre werden hart – aber sie sind nicht verloren
Die Große Koalition wird weder das Klima retten noch soziale Gerechtigkeit herstellen. Das bedeutet: Wir müssen beides selbst tun.
Wenn wir es nicht schaffen, soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz zu verbinden, dann wird das Ergebnis eine doppelte Katastrophe sein: Ein ökologischer Zusammenbruch kombiniert mit einer massiven Rechtsverschiebung.
Doch genau das können wir verhindern – nicht durch Appelle an die Politik, sondern durch aktiven Widerstand, Vernetzung und den Aufbau eigener Strukturen.
Wenn ich eines in den letzten Wochen gelernt habe, dann ist es, dass wir positiv in die Zukunft schauen müssen – nicht aus Naivität, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, etwas zu verändern. Wer nur das Schlechteste erwartet, bleibt in Resignation gefangen und verliert die Kraft zum Handeln. Doch blinder Optimismus ist ebenso wenig hilfreich. Der Weg liegt dazwischen: eine klare Sicht auf die Realität, verbunden mit der Überzeugung, dass Veränderung möglich ist. Nur so können wir Menschen erreichen, Perspektiven aufzeigen und echte Alternativen entwickeln. Schlechte Nachrichten gibt es genug – es liegt an uns, den Mut und die Entschlossenheit zu finden, um trotzdem weiterzumachen.

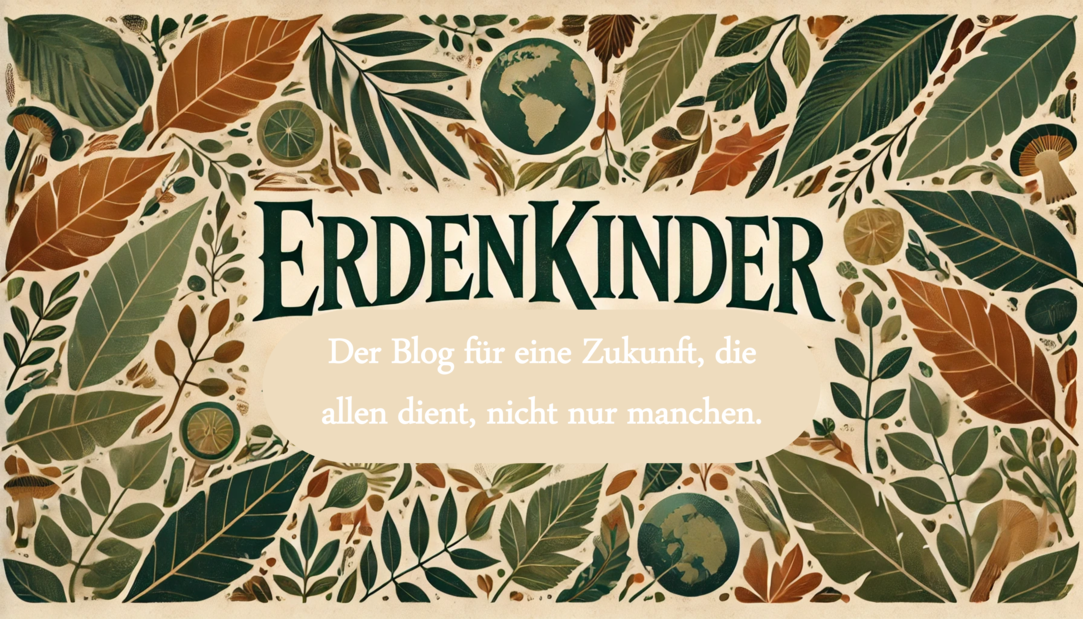

Schreiben Sie einen Kommentar