Warum wir Intelligenz neu denken müssen
Elon Musk sagte in einem Interview mit Joe Rogan sinngemäß:
„Die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie.“
Er nennt sie eine zivilisatorische Gefahr. Ein Akt der Schwäche. Ein Tor für den Feind.
Diese Worte stammen von einem der einflussreichsten Unternehmer unserer Zeit – einem Mann, der Raketen baut, Gehirnchips entwickelt und sich selbst als Retter der Menschheit inszeniert. Und doch spricht hier kein visionärer Denker, sondern ein Prototyp jener maskulinen Kurzsichtigkeit, die unsere Welt an den Rand des Zusammenbruchs führt: technologisch fortgeschritten, aber emotional primitiv.
Ich habe in meinem Buch „Sei lieb zu deinen Frauen“ geschrieben:
„Für Männer gilt ein Mensch als intelligent, der aus einer Situation das Beste für sich herausholt. Für Frauen hingegen gilt ein Mensch als intelligent, der alle Folgen des eigenen Handelns mitdenkt – und daraus das Beste für alle macht.“
Diese Unterscheidung ist nicht akademisch. Sie ist politisch. Sie ist ökologisch. Sie ist zivilisatorisch. Und sie könnte der Schlüssel dazu sein, zu verstehen, warum wir als Spezies gerade versagen.
Denn was, wenn das eigentliche Problem nicht ein Mangel an Intelligenz ist – sondern ein fatal einseitiges Verständnis davon? Was, wenn wir in Wahrheit nicht an der Komplexität der Welt scheitern, sondern an der Arroganz, sie im Alleingang meistern zu wollen? Und was, wenn die Lösung darin besteht, das Weibliche Denken – das empathische, beziehungsorientierte, systemisch vernetzte Denken – nicht länger als Schwäche, sondern als höhere Form von Intelligenz zu begreifen?
In diesem Beitrag will ich den Versuch unternehmen, Intelligenz neu zu denken. Jenseits von IQ, Jenseits von Dominanz. Jenseits der zerstörerischen Vereinfachung, die uns einredet, Empathie sei Schwäche.
Männliche Intelligenz – Der Mythos vom Sieger im System
In der Erzählung, die unsere Gesellschaft über Intelligenz spinnt, taucht immer wieder dieselbe Figur auf: der smarte Macher, der alles im Griff hat. Der sich durchsetzt. Der aus jeder Situation als Gewinner hervorgeht – ganz gleich, wie viele andere auf der Strecke bleiben. Seine Intelligenz misst sich an Schlagfertigkeit, strategischer Kälte und der Fähigkeit, aus der Welt eine Bühne für den eigenen Aufstieg zu machen. Wir bewundern ihn, beneiden ihn, wählen ihn.
Doch was, wenn das alles gar nicht intelligent ist?
Was, wenn dieses Denken – vermeintlich rational, zielgerichtet, effizient – in Wahrheit dumm ist, weil es nur kurzfristig funktioniert, nur für eine kleine Gruppe, und nur um den Preis kollektiver Schäden?
Diese Form von Intelligenz ist, so scheint es, männlich codiert. Nicht, weil Männer biologisch so denken, sondern weil unsere Kultur ihnen seit Generationen einredet, dass emotionale Selbstbegrenzung, Konkurrenz und Durchsetzungsvermögen der Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung sind. Wer empathisch ist, verliert. Wer teilt, zeigt Schwäche. Wer fragt, gilt als unsicher.
Das Ergebnis: eine hypertrophe Intelligenz, die sich selbst genügt – aber keine Verantwortung trägt. Die ihren eigenen Erfolg feiert – aber nicht erkennt, dass sie gerade die Grundlagen für das zerstört, was sie triumphierend überragt.
Weibliche Intelligenz – Denken in Beziehung
Dem männlich konnotierten Denken steht ein anderer Modus gegenüber – einer, der oft übersehen, belächelt oder abgewertet wird. Es ist ein Denken, das nicht vom Ich ausgeht, sondern vom Wir. Kein Denken, das sich fragt: Was springt für mich dabei raus?, sondern: Wie wirkt mein Handeln auf die, mit denen ich verbunden bin?
Dieses Denken ist nicht zufällig weiblich konnotiert. Denn historisch, kulturell und bis heute im Alltag tragen vor allem Frauen die Verantwortung für Beziehungen. Sie managen nicht nur Haushalte, sondern auch emotionale Spannungsfelder, soziale Dynamiken, Kommunikationsströme. Sie lernen früh, dass man nicht einfach „das Beste für sich“ machen kann, ohne das Ganze mitzudenken. Dass Überleben immer ein kollektiver Akt ist.
Weibliche Intelligenz – im kulturellen, nicht biologischen Sinn – ist eine systemische Intelligenz. Sie sieht Zusammenhänge, erkennt Wechselwirkungen, spürt Spannungen, bevor sie eskalieren. Sie ist leise, geduldig, oft unsichtbar – und gerade deshalb so wirksam.
Zivilisation ohne Herrschaft – Intelligenz jenseits von Macht
Was wäre, wenn das, was wir heute als „Zivilisation“ feiern – Städte, Staaten, Führer, Strategien, Kriege – gar nicht der Ursprung von Intelligenz ist, sondern ein Irrweg?
Die Induskultur (ca. 2600–1900 v. Chr.) gilt heute als eine der frühesten Hochkulturen der Menschheit. Ihre Städte wie Mohenjo-Daro oder Harappa waren beeindruckend organisiert: Kanalisation, einheitliche Gewichte, Architektur in geometrischer Logik. Aber was auffällt: Es gibt keine Paläste. Keine Königsgräber. Keine Waffen. Keine Hinweise auf zentrale Herrschaft.
Eine Zivilisation ohne sichtbare Eliten. Ohne Gewaltkult. Ohne Heroenmythos.
Vergleichen wir das mit Wäldern – ebenfalls hochkomplexe Systeme, in denen Pilznetzwerke („Wood Wide Web“) die Kommunikation organisieren. Nährstoffe werden geteilt, junge Bäume gefördert, Kranke unterstützt. Kein Baum will „gewinnen“. Alle wollen erhalten bleiben – gemeinsam.
Oder die Bonobos: Anders als ihre aggressiveren Schimpansen-Verwandten haben sie ein matriarchales Gesellschaftssystem, in dem Konflikte oft durch Nähe, Körperkontakt und Sexualität reguliert werden.
Beziehung macht klug – Isolation macht dumm
Wir leben in einer Gesellschaft, die Intelligenz oft als etwas Inneres begreift – als messbare Eigenschaft im Kopf. Aber was, wenn das nur die halbe Wahrheit ist?
Studien zeigen: Menschen, die wenig soziale Bindung und wenig physischen Kontakt haben, schneiden bei Intelligenztests signifikant schlechter ab. Ihre kognitive Leistungsfähigkeit nimmt ab.
Isolation macht dumm. Nicht, weil diesen Menschen etwas fehlt – sondern weil unser Gehirn als soziales Organ funktioniert.
Empathie ist Zivilisation
In einem System, das Dominanz belohnt und Beziehung als Schwäche diffamiert, erscheint Empathie schnell als Störfaktor. Elon Musk nennt sie gar eine „zivilisatorische Schwäche“.
Aber was, wenn genau das Gegenteil stimmt?
Empathie ist keine sentimentale Zugabe. Sie ist keine „Emotion“, die der Vernunft im Weg steht. Sie ist die Vernunft – in Beziehung gedacht.
Empathie ist kein Gegenpol zur Intelligenz – sie ist ihre soziale Form.
Rekursion: Was wir im Spiegel dieses Textes erkennen
Wenn wir von Elon Musk zu Mohenjo-Daro gehen, von Bonobos zu Trump, von Pilznetzwerken zur Intelligenzteststatistik, dann tun wir mehr, als nur zu vergleichen. Wir kartieren eine verborgene Landschaft. Eine Landschaft, in der sich unsere kulturelle Vorstellung von Intelligenz offenbart – und dabei entlarvt.
Diese Rekursion führt nicht zurück an den Anfang – sondern nach innen.
Sie macht sichtbar, dass jedes Element dieses Textes ein Spiegel ist:
Der Bonobo spiegelt den Menschen.
Die Induskultur spiegelt unsere eigene Hybris.
Der Körper spiegelt den Geist.
Das Weibliche spiegelt das Verdrängte.
Abschluss: Mehr Mut(ter) wagen?
Vielleicht ist unsere alte Redensart „Alle doof außer Mutter“ gar nicht so falsch.
Nicht, weil „Mutter“ alles besser weiß – sondern weil sie vielleicht noch spürt, was andere längst verdrängt haben: Dass Intelligenz nicht bedeutet, immer Recht zu haben.
Sondern zu merken, wenn etwas falsch läuft. Und dann für alle das Beste zu wollen.
Also vielleicht ist es an der Zeit, dass wir als Gesellschaft mal wieder ein bisschen mehr Mut(ter) wagen – nicht als Mama, sondern als Prinzip:
Mehr Beziehung. Mehr Empathie. Mehr Intelligenz, die nicht siegt, sondern trägt.

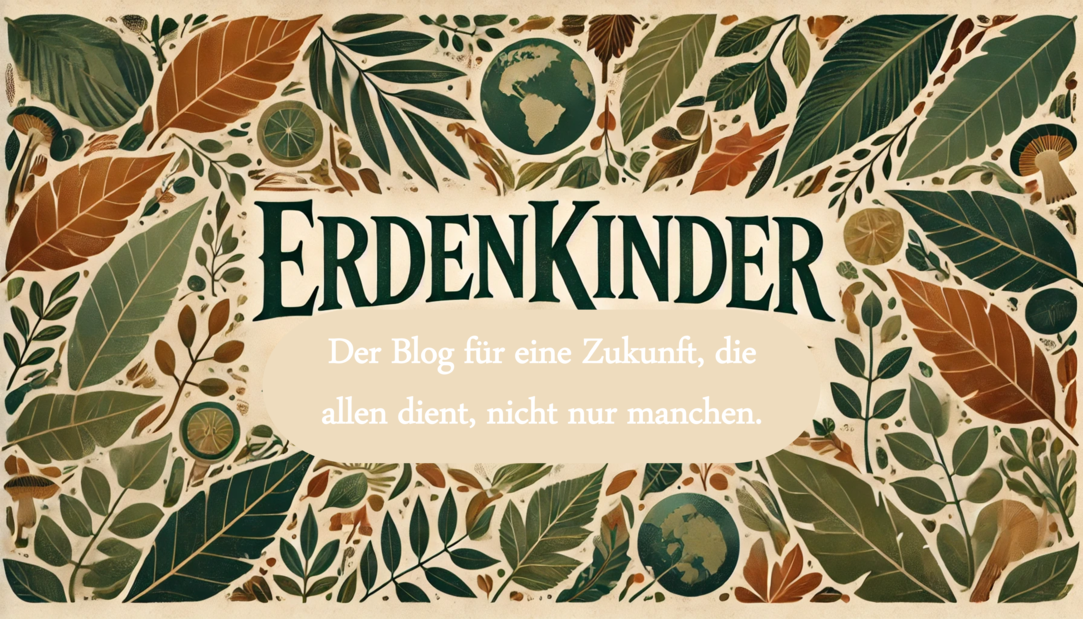

Schreiben Sie einen Kommentar